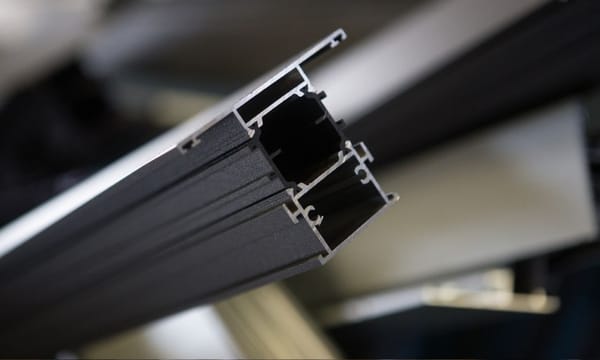Doping im Alltag: Immer besser um jeden Preis?

Freitagnachmittag, der Blick wandert alle paar Sekunden zur Uhr, für mehr reicht die Kraft einfach nicht mehr aus: Die Woche war lang, der Stresslevel mindestens so hoch wie der Leistungsdruck und jetzt geht einfach gar nichts mehr. Außer dem Alltag, der geht nämlich spätestens Montag weiter und zwar genauso. Was tun, wenn man dem Hamsterrad nicht entkommen kann? Man beugt die Regeln zu seinen Gunsten – und hilft dem Körper mit jedem denkbaren Mittel auf die Sprünge.
Das Streben nach Verbesserung
Oscar Wilde war, so könnte man glauben, ein einfacher Mann mit einfachen Ansprüchen. Ihm genügte das Beste zu seiner völligen Zufriedenheit. Das klingt nach angenehmem In-sich-Ruhen. Eine Fähigkeit, die unserer modernen Leistungsgesellschaft irgendwie abhandengekommen zu sein scheint, in der selbst das Beste nicht genug und der Maßstab immer das „Besser“ ist. Fitter, schöner, schlauer, leistungsfähiger – das Streben nach Verbesserung, nach einer Optimierung, die möglicherweise nie erreicht wird, das ist eines der Hauptanliegen unserer Zeit. Gut finden muss man das nicht, das zum Teil erreichte Ausmaß kann einen stattdessen auch mal ankotzen, aber das Phänomen lässt sich dadurch kaum vertreiben.
Dazu sind sämtliche Mittel recht, von der Ernährungsumstellung über das ausgedehnte Fitnessprogramm bis hin zu Schönheitsoperationen und leistungssteigernden Substanzen. Sie stehen schließlich in einem breitgefächerten Angebot zur Verfügung. Dass sich dahinter ein großer Widerspruch verbirgt und ein solches Streben im schlimmsten Fall keineswegs die Verbesserung bringt, die wir so gerne erreichen wollen – wird meistens ausgeblendet. Das Beste wird ohnehin jetzt von uns erwartet, da gilt es, keine Zeit zu verlieren.
An der Stelle schließt sich der Teufelskreis, der mit dem hohen Leistungsdruck im Job, im Studium, in der Schule anfängt, sich auf die Freizeit ausdehnt (freie Zeit bedeutet schließlich keine Freiheit von Leistungserwartungen) und an dessen Ende ein noch höherer Leistungsdruck steht. Vielleicht doch gar nicht so einfach, sich immer mit dem Besten zufrieden geben zu wollen.

Verbesserung, überall, mit allem
Umgekehrt gibt es selbstverständlich schier unendliche Möglichkeiten, sich dem Besten wenigstens anzunähern. Darunter dürften sportliche Aktivitäten jene sein, die sich – jedenfalls ohne den Einsatz technischer oder chemischer Hilfsmittel – zumindest über einen breiten gesellschaftlichen Konsens freuen dürfen. Wobei das in Einzelfällen vom absolvierten Trainingspensum abhängen mag, aber was genau jetzt zu viel des Guten ist, bleibt ja im Auge des Betrachters. Dass es auch ein grundsätzliches Unverständnis dafür geben könnte, sich nach einem langen Arbeitstag noch freiwillig im Fitnessstudio oder auf der Lieblingslaufstrecke zu quälen – davon geht ja nun wirklich niemand aus.
Beim sogenannten Functional Food hingegen wird es mit dem Konsens schon deutlich schwieriger. Zumindest dürften nicht alle Menschen der Ansicht sein, dass ihr Essen vorwiegend nach der Art und Weise zusammengestellt werden sollte, in der es zu einer Verbesserung der Physis beitragen kann. Die Skepsis rührt unter anderem daher, dass die in vielen Lebensmitteln enthaltenen funktionellen Beigaben (Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe oder die allseits bekannten linksdrehenden Joghurtkulturen) ohne weiteres mit „normaler“ Kost konsumiert werden können. In ausreichender Menge und mit nachgewiesener Wirkung. Genau dieser Nachweis fehlt vielen funktionellen Lebensmitteln aber.
Theoretisch lässt sich der Verbesserungsbegriff auf nahezu alle Methoden und Praktiken anwenden, die in irgendeiner Form eine positive Veränderung des psychischen und/oder physischen Zustands herbeiführen können. Ein weites Feld, würde Fontane an diesem Punkt wohl einwerfen, und er hätte sicherlich Recht damit: Unter diesen Voraussetzungen sind schließlich Formen der Selbstverschönerung (von Operationen bis zu Tätowierungen) im selben Topf wie Formen der Selbstkultivierung (angefangen beim Training bis hin zum Lernen im Allgemeinen).
Dabei ist damit immer noch nicht die gesamte Bandbreite möglicher Verbesserungsmethoden abgedeckt. Allerdings bewegt man sich bei allem, was darüber hinausgeht, in Bereichen, die verdächtig nach Doping aussehen.

Wo Doping anfängt
Dabei wird das, was im Spitzensport seit langem ein großes Thema ist, in unserem Alltag allem Anschein nach als viel weniger problematisch wahrgenommen. Im Gegenteil ist die Einnahme verschiedenster Substanzen, mit denen die Leistung gesteigert, der Stress überwunden und Ängste ausgeblendet werden können, ein weit verbreitetes Phänomen. Das muss man nicht gut finden, aber an den Fakten ändert das erst einmal nichts.
Im Prinzip zeigt sich an diesem Umstand auch nur, dass es jenseits vom Bereich des professionellen Sports eine sehr viel größere Notwendigkeit gibt, die Doping-Problematik zu benennen und zu erörtern. Schon deshalb, weil der Leistungssport nicht zuletzt durch die Richtlinien der Welt-Doping-Agentur WADA eine klare Meinung dazu hat, wo Doping anfängt und wo es sich um eine legale Form der Leistungssteigerung handelt.
Davon ist das Doping im Alltag noch weit entfernt, obwohl es ein seit vielen Jahren bekanntes Problem ist. Sich selbst Anti-Depressiva zu verabreichen, um den Bürostress besser und länger aushalten zu können, ohne aber an einer Depression zu leiden, ist nicht verboten. Wird es dadurch aber richtig? Es fehlen die Grenzziehungen oder anders ausgedrückt: Es fehlen die Grenzziehungen, die auf sachlicher Ebene entstanden sind und nicht in einer Auseinandersetzung, in der in erster Linie Weltanschauungen gegenübergestellt werden. Kein einfacher Prozess, wie der Beitrag von Dr. Christoph Binkelmann zeigt, auch nicht im Leistungssport. Überhaupt trifft es „Prozess“ noch am besten, denn das Thema bedarf auf vielen Ebenen nach wie vor der Diskussion.

Enhancements und warum es damit (nicht zwingend) besser wird
Zum Beispiel darüber, ob sich der grundlegende Sachverhalt durch eine andere Begrifflichkeit in irgendeiner Weise ändert. Das Stichwort lautet in dieser Hinsicht „Enhancements“. Dahinter verbirgt sich der Einsatz pharmakologischer, chirurgischer oder biotechnischer Eingriffe mit dem Ziel, bei gesunden Menschen eine Verschönerung, Verbesserung oder Leistungssteigerung herbeizuführen. Eine Schönheitsoperation oder ein Tattoo fallen damit bereits in die Kategorie Enhancement, würden aber nachvollziehbarerweise niemals mit Doping in Verbindung gebracht werden.
Ganz anders liegt der Fall, ebenso nachvollziehbarerweise, wenn es in den pharmazeutischen Bereich geht. Hier stellt sich schon auf der Begriffsebene die Frage, ob es sich bei der Bezeichnung Enhancement nicht strenggenommen nur um ein Synonym für Doping handelt. Im Kern geht es ja in beiden Fällen darum, durch die Einnahme von pharmazeutischen Hilfsmitteln die Leistung zu optimieren. Trotzdem ist in mancher Hinsicht eine Unterscheidung zu treffen, nämlich unter anderem die, wofür und in welchem Rahmen die Mittel eingesetzt werden.
Viele Medikamente wirken schließlich nur auf die körperliche Leistung und Disposition:
- Narkotika etwa unterdrücken Schmerzen und erlauben es dadurch, häufiger und mit höherer Intensität zu trainieren.
- Anabole Steroide beschleunigen den Muskelaufbau, genauso wie Somatotropin, das auch unter der Bezeichnung Wachstumshormon bekannt ist.
- Diuretika dienen eigentlich der Entwässerung des Körpers (beispielsweise bei Wassereinlagerungen in Folge einer Herzschwäche), helfen so aber auch dabei, schneller Gewicht zu verlieren.
- Amphetamine und Ephedrin gehören zu den Stimulanzien, deren Zweck darin besteht, für ein Aufputschen zu sorgen, bei dem die motorischen Fähigkeiten ebenso gesteigert werden wie die Risikobereitschaft.
Alle diese Medikamente sind aus ihrem Zusammenhang zum Sport bekannt und zwar nicht nur aus dem Bereich des Profisports, sondern weil sie inzwischen auch im Breitensport angekommen sind. Der, im allgemeinen Sprachgebrauch, klassische Tatbestand des Dopings: Medikamentös unterstützte Leistungssteigerung, bei der gleichzeitig das moralische Problem einer betrügerischen Absicht dazugehört.
Nebenbei bemerkt: Daran ändert auch die seit Jahren übliche Praxis nichts, nach dem Verbot einer Substanz nach Alternativen zu suchen, die noch nicht auf dem Index stehen. Schon deswegen nicht, weil bei dieser Praxis absehbar ist, dass sie zu keinem legalen Mittel führen kann.
Es ist vor allem die moralische Verwerflichkeit, die den Dopingbegriff in seinem alltäglichen Gebrauch geprägt hat. Dazu kommen die teils heftigen gesundheitlichen Folgen, die bis hin zum Tod führen können, das geheime Getue und der Bezug der Mittel über Schwarzmärkte und andere dubiose Quellen. Ein schmutziges Geschäft, könnte man sagen, und diese Einschätzung deckt sich mit der medialen Darstellung. Dazu gab und gibt es erschreckend häufig Anlass, wie die Enthüllungen um das in Russland betriebene Staatsdoping und die wiederkehrenden Fälle bei sportlichen Großveranstaltungen zeigen. Die ARD hat daraus gleich eine mehrteilige Reportage-Reihe gemacht. Dass diese Darstellung also richtig ist, steht deshalb hier auch gar nicht zur Debatte, sofern sie sich um den richtigen Kontext dreht.
Die vielen Gesichter des Dopings
Und der Kontext, in dem Doping stattfindet, ist eben längst nicht mehr der Sport allein. Was sich im ebenfalls im Sprachgebrauch erkennen lässt: Lifestyle-Doping. Alltags-Doping. Berufs-Doping. Gehirn-Doping. Um nur einige Begriffe zu nennen, die mittlerweile weithin gebräuchlich sind und die zeigen, welche gesellschaftliche Verbreitung das Phänomen Doping inzwischen erreicht hat. Wenn man es denn so nennen will.

Betrachtet man vornehmlich den Aspekt der betrügerischen Absicht und der unzulässigen Übervorteilung anderer, ist es das gewissermaßen nicht. Genauso wenig, wenn der Fokus auf die rein physische Optimierung gelegt wird. In allen genannten Fällen geht es in erster Linie um die Leistungssteigerung für die eigenen Zwecke, ohne einen Wettbewerbshintergrund und nahezu immer um die kognitiven Fähigkeiten oder die Stressbewältigung.
Weshalb in diesen Zusammenhängen vorzugsweise von (Neuro-)Enhancements gesprochen wird. Außerdem weisen Experten auf die anderen Vorzeichen hin, die solche Enhancements von Doping unterscheiden: Eine Leistungssteigerung mittels Medikamenten, die nicht die üblichen, bedenklichen Nebenwirkungen haben und die von jedem gänzlich freiwillig ausgewählt und verwendet werden können, sei keinesfalls mit Doping zu vergleichen.
Damit sind aber in vorläufig nur die Voraussetzungen beschrieben, unter denen Enhancements aus dem Dunstkreis des Dopings herausgezogen werden können. Auch darauf weisen Experten hin, denn obwohl die hypothetischen Möglichkeiten einer Optimierung des Geistes sehr weit reichen, so ist der gesellschaftliche Stellenwert der Neuro-Enhancements noch weitgehend unklar. Anders ausgedrückt: Die Praxis, sich mit Medikamenten durch den stressigen Alltag zu helfen, ist zwar relativ weit verbreitet. Wirklich anerkannt als legitimes Mittel ist dadurch aber eben nicht.
I Don’t Like The Drugs
Was unter anderem zu einer sachlicheren Auseinandersetzung rund um das Thema Neuro-Enhancements führen könnte, wäre ein genauerer Blick darauf, was sich hinter den zu diesem Zweck verwendeten Substanzen verbirgt. Der Begriff „Medikamente“ ist in dieser Hinsicht irreführend, weil er den Blick für eine ganze Palette anderer Mittel verstellt, mit denen sich auch auf das Gehirn einwirken lässt – und die bei genauerem Hinsehen schon längst feste Bestandteile unseres Alltags sind, ohne sie bei Bedarf aus der Apotheke beziehen zu müssen.
Zu den am häufigsten für das Gehirn-Doping eingesetzten Substanzen gehören nämlich:
-
- Koffein: Der Stoff, der ganze Bürogemeinschaften zusammen- und am Leben hält und Studenten durch ihr Studium trägt. Allerdings entfaltet Koffein seine Wirkung am stärksten bei Leuten mit Schlafentzug, ansonsten sind die Resultate, die sich mit Kaffee, Tee oder Kakao erzielen lassen, vergleichsweise überschaubar.
- Energydrinks: Die verleihen eben nicht nur Flügel, sondern sollen eben besonders beim Wunsch helfen, die Müdigkeit möglichst lange oder möglichst ganz fernzuhalten. Nicht umsonst erfreuen sich Energydrinks gerade bei Feiernden größter Beliebtheit, Warnungen bezüglich möglicher Nebenwirkungen spielen da keine Rolle. Die Basis ist üblicherweise auch hier Koffein, alle anderen zugefügten Substanzen dienen nur dazu, dessen Wirkung zu verstärken.
- Nikotin: Nicht zwingend bekannt für eine aufputschende Wirkung, aber dafür umso beliebter, wenn es um Möglichkeiten geht, Stress abzubauen. Insofern ist Nikotin vielleicht kein Neuro-Enhancer in der Hinsicht, dass damit eine Leistungssteigerung zu erwarten wäre. Andererseits muss man genau davon sprechen, wenn der Konsum dazu führt, länger unter stressigen Bedingungen seine Aufgaben zu erfüllen, als es ansonsten möglich wäre.
Neben diesen, zumindest für Erwachsene frei zugänglichen Soft-Enhancern gibt es selbstverständlich eine ganze Reihe von chemischen Substanzen, die in den meisten Fällen entweder unter das Arzneimittel- oder das Betäubungsmittelgesetz fallen:
- Psychostimulanzien: Neben D‑Amphetamin dürfte Methylphenidat zu den bekanntesten Psychostimulanzien, weil es in Ritalin enthalten ist. Das ADHS-Medikament soll zwar eigentlich – zumindest bei dieser Diagnose – eine beruhigende Wirkung entfalten, hat sich aber gerade unter Studenten als beliebte „Lerndroge“ etabliert: Es hilft dabei, die Konzentration auf den Lernstoff zu fokussieren und „störende“ Gehirnaktivität zu unterbinden.
- Modafinil ist ebenfalls ein Stimulans, mit einer ähnlich beschränkten Wirkungsweise wie Koffein: Gesunde, ausgeschlafene Menschen können nicht unbedingt auf einen Vorteil für ihre kognitive Leistung hoffen, bei Schlafentzug allerdings lassen sich Stimmung, Reaktionszeit, logisches Denken etc. deutlich verbessern – mit dem Risiko einer nicht unerheblichen Zahl an Nebenwirkungen, Vergiftungen inbegriffen.
Probiert wurde darüber hinaus bereits vieles, über Antidementiva und Antidepressiva bis hin zu Drogen. An ihrer Wirkung im Sinne eines tatsächlichen Gehirn-Dopings muss allerdings gezweifelt werden. Auch Phytopharmaka, also Heilmittel, die aus Pflanzen gewonnen werden, und Nahrungszusätze standen und stehen in der Diskussion, wenn es um Leistungssteigerungen geht. Mit Kaffee, Tee und Kakao wurden die verbreitetsten Vertreter bereits genannt. Mit Beta-Blockern, die üblicherweise an Herzpatienten verschrieben werden, wird gelegentlich versucht, die Adrenalinausschüttung im Körper zu hemmen und Stresssymptome zu unterbinden.
Die Liste an Mitteln und unterschiedlichen Verwendungszwecken ließe sich noch deutlich weiterführen, das Interesse an den Möglichkeiten des Neuro-Enhancements sind offenbar groß genug – und zwar nicht nur aus der Perspektive der Mediziner. Der Markt für derlei Produkte ist ganz offensichtlich vorhanden.

Doch kein Massenphänomen?
Wobei Studien zum pharmakologischen Neuro-Enhancement auf den ersten Blick keine wirklich alarmierenden Zahlen liefern: Das DAK-Gesundheitsreport-Update „Doping am Arbeitsplatz“ musste vor wenigen Jahren zwar feststellen, dass sich die Zahl der Arbeitnehmer mit einschlägigen Erfahrungen im Umgang mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (die sie notwendigerweise nicht bräuchten) erhöht hat. Aber ein Anteil von 6,7 Prozent klingt angesichts wiederholter Warnungen vor diesem Thema und der Darstellung als Massenphänomen wenig beeindruckend.
Erfasst ist damit aber auch nur die Spitze des Eisbergs, die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich mindestens doppelt so hoch. Außerdem zu berücksichtigen: Gehirn-Doping ist nichts, was auf das Berufsleben im engeren Sinne beschränkt ist. Im Gegenteil wird es von Studenten und Schülern genutzt, wobei es mit belastbaren Aussagen über das quantitative Ausmaß – sowohl was die Zahl derjenigen betrifft, die irgendwelche leistungssteigernden Substanzen einnehmen als auch bezüglich der Regelmäßigkeit des Konsums – so eine Sache ist. Fakt bleibt aber, dass die Praxis nicht nur unter Berufstätigen verbreitet ist und in der einen oder anderen Form bis hinein in die Schulen reicht.
Das (moralische) Dilemma
Am Ende laufen diese Entwicklungen auf die alles entscheidende Frage hinaus: Ist Alltags-Doping eine vertretbare Methode, um mit den Anforderungen des Berufslebens und der Freizeitgestaltung Schritt halten zu können? Das ist keine einfache Ja-oder-Nein-Frage, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte, denn die Frage nach der Vertretbarkeit von Neuro-Enhancements betrifft ganz unterschiedliche Dimensionen:
- Die ethische Ebene
Die haben wir bereits beim Versuch der Unterscheidung zwischen Doping im klassischen Sinne und dem Doping ohne betrügerische Absicht angeschnitten. Ist das ein stichhaltiges Argument? Bedeutet denn nicht, wenn ich meine Leistung medikamentös verbessere, während andere darauf verzichten, dass ich diese übervorteile? Und zwar jenseits meiner eigentlichen Fähigkeiten und Kapazitäten?
Dabei geht es gar nicht so sehr um die Frage, ob derartige Eingriffe in die Natur des Menschen erlaubt sein sollten oder nicht – denn das würde, genau genommen, die Medizin als solche komplett in Frage stellen. Skepsis ist trotzdem angebracht, nicht nur, wenn es um die Gehirne unserer Kinder geht. Erlaubt sein muss darüber hinaus der Hinweis auf die Vorteilnahme, auch auf Kosten anderer. Wir leben schließlich immer noch in einer Leistungsgesellschaft, aber sollte es nicht auch dafür gewisse Regeln geben?
- Die soziale Ebene
Damit bewegen wir uns allerdings schon mehr im Bereich der sozialen Aspekte. Wer greift zu (Neuro-)Enhancements, was sind die Gründe, was sind die Folgen? Wer hat überhaupt Zugang zu den leistungsfördernden Mitteln?
Die gesellschaftlichen Konsequenzen sind in ihrer Tragweite kaum abzuschätzen, die steigende Tendenz, sich per Selbstmedikation für die Belastungen des Alltags zu präparieren, zeigt aber einige elementare Mechanismen: Zum Beispiel eine individuell wahrgenommene Notwendigkeit, dem bestehenden Leistungs- und Konkurrenzdruck standzuhalten.

Das wäre kaum als Verbesserung zu bezeichnen, um die es doch aber gehen soll. Vor allem dann nicht, sollte hieraus sozialer Druck entstehen, durch den die Einnahme eben nicht mehr auf freiwilliger Basis stattfindet. Hintergrund ist hier das bekannte Gruppenzwang-Dilemma. Mit dem Unterschied, dass die negativen Folgen im Zusammenhang mit anderen Substanzen – angefangen bei Nikotin bis hin zu harten Drogen – leichter zu erkennen sind, was ein „Nein“ wiederum leichter macht. Was aber, wenn mir berufliche Nachteile entstehen, weil ich im Gegensatz zu anderen nicht alle Möglichkeiten ausschöpfe?
- Die rechtliche Ebene
Nicht unerheblich ist auch die Frage, wie solche medikamentösen Verbesserungen rechtlich gehandhabt werden sollen – oder ob sie das überhaupt sollten. Bei Enhancements geht es schließlich nicht um eine Therapie im eigentlichen Sinne und das führt mehr oder weniger unweigerlich zurück zur Doping-Debatte, die nun einmal ganz eindeutig eine juristische Seite hat. Einer der Gründe, warum die Diskussion zu Neuro-Enhancements auch auf politischer Ebene geführt wird.
Damit hängt auch die Frage zusammen, wie die Nutzer überhaupt an ihre Wachmacher, Aufputscher und Konzentrationsförderer kommen – viele davon sind verschreibungspflichtig oder fallen sogar unter das Betäubungsmittelgesetz. Müsste dann bei Verschreibungen durch Ärzte oder den Verkauf im Internet nicht genauer hingesehen werden?
Viele Fragen und sie zeigen vor allem den Bedarf an einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der Thematik. Sollte Alltagsdoping irgendwann doch zum prophezeiten Massenphänomen werden, sind die Folgen derzeit noch kaum abzusehen. Nicht einmal für den Einzelnen. Eine Eskalation wie bei Luc Bessons „Lucy“ steht zwar (noch?) nicht zu befürchten. Wer sich aber Bradley Cooper in „Ohne Limit“ angesehen hat, der weiß, dass die grenzenlosen Möglichkeiten der eigenen Leistungsfähigkeit immer ihren Preis haben. Und der betrifft vor allem die eigene Gesundheit.
Ohne ärztliche Kontrolle und Begleitung scheint es jedenfalls kaum vorstellbar, dass pharmakologische Enhancements die Art von Verbesserungen für Einzelpersonen und die Gesellschaft als solche bringen, wie sie in optimistischeren Szenarien angepriesen werden. Mit dem Gehirn sollte jedenfalls nicht leichtfertig gespielt werden. Eine ganz legale Möglichkeit wäre es dagegen, die Stresssymptome mit der passenden Musik zu bekämpfen.