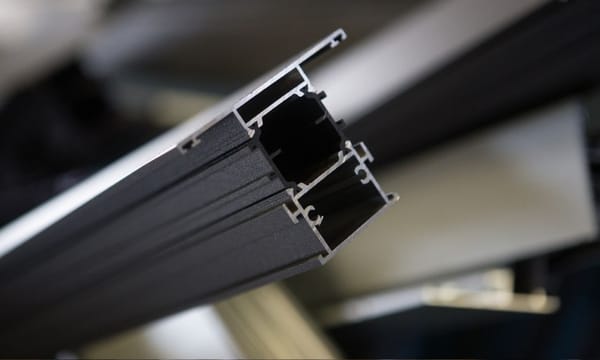Fischstäbchen im Stiftung Warentest: Schadstoffe, Gesundheit und Nachhaltigkeit

Beliebter Klassiker mit unerwartetem Risiko: Fischstäbchen gehören in vielen Haushalten zu den Favoriten auf dem Teller – besonders bei Kindern. Umso alarmierender wirken aktuelle Berichte, wonach in den goldbraun panierten Stäbchen ein potenziell gesundheitsgefährdender Stoff nachgewiesen wurde. Die Rede ist von 3-Monochlorpropandiol (3-MCPD), einem sogenannten Fettschadstoff. Was hat es mit 3-MCPD auf sich, welche Gefahren sind wissenschaftlich bekannt und wie viele Fischstäbchen gelten noch als unbedenklich? Wir von der 2GLORY-Redaktion haben die Fakten geprüft und fassen zusammen, was Verbraucher über Gesundheitsrisiken, Testergebnisse und sogar die Umweltaspekte von Fischstäbchen wissen sollten.
Gesundheitsrisiko 3-MCPD: Wie entsteht der Schadstoff und warum ist er gefährlich?
3-MCPD ist ein prozessbedingter Schadstoff, der vor allem dann entsteht, wenn pflanzliche Öle oder Fette sehr stark erhitzt werden. Genau das passiert bei der Herstellung von Fischstäbchen: Die dünnen Fischfilets werden vorgebraten (oft in Pflanzenöl) und anschließend tiefgefroren. Bei Temperaturen ab etwa 180 °C können sich in dem verwendeten Öl 3-MCPD-Fettsäureester bilden. Diese Verbindungen selbst sind nicht direkt aktiv, werden aber im Verdauungstrakt in freies 3-MCPD umgewandelt. Laut dem Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) hat freies 3-MCPD in Tierversuchen ab bestimmten Dosen Tumore ausgelöst; beim Menschen steht der Stoff im Verdacht, die Nieren zu schädigen und – in hohen Dosen – das Wachstum gutartiger Tumore zu fördern. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) stuft 3-MCPD vorsorglich als „möglicherweise krebserregend“ für den Menschen ein (Gruppe 2B). Aus diesen Gründen sind sich Experten einig, dass die Aufnahme so gering wie möglich gehalten werden sollte.
Um Verbraucher zu schützen, wurde ein höchst tolerierbares Aufnahmelimit festgelegt. Der wissenschaftliche Lebensmittelausschuss der EU (SCF) hat bereits 2001 einen TDI-Wert (Tolerable Daily Intake) von 2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag bestimmt. Das bedeutet: Bis zu dieser Menge gilt eine tägliche Aufnahme lebenslang als wahrscheinlich unbedenklich. Überschreitungen dieses Werts sollten dagegen vermieden werden, da dann ein gesundheitliches Risiko nicht mehr auszuschließen ist. Besonders bei kleinen Kindern kann die TDI-Grenze durch bestimmte Lebensmittel nämlich schnell erreicht oder überschritten werden. Hier kommen die Fischstäbchen ins Spiel – denn gerade sie stehen bei Kindern häufig auf dem Speiseplan.
Testergebnisse: Verbraucherschützer schlagen Alarm wegen Fettschadstoffen
Angesichts der potenziellen Gefahr hat die Stiftung Warentest zuletzt genauer hingeschaut. In ihrer Märzausgabe 2024 untersuchte sie insgesamt 19 Produkte – darunter 11 klassische Fischstäbchen (meist Alaska-Seelachs), 4 sogenannte Backfischstäbchen (dicker umhüllte Fischstücke) und 4 vegane Alternativen. Das Ergebnis sorgte für Aufsehen: In rund 60 % der Proben wurden auffällig hohe 3-MCPD-Gehalte festgestellt, die zu Abwertungen in der Qualitätsurteil führten. Mit anderen Worten: Mehr als die Hälfte der gängigen Fischstäbchenprodukte wies so viel 3-MCPD-Fettsäureester in der Panade auf, dass es die Bewertung deutlich verschlechterte. Kein einziges getestetes Produkt war frei von diesen unerwünschten Stoffen – kein Fischstäbchen erhielt die Note “Sehr gut”.
Besonders kritisch fiel das Urteil bei einzelnen Marken aus. So entdeckten die Warentester in der Panade eines Produktes doppelt so viel 3-MCPD-Ester, wie für das verwendete Speiseöl in der EU erlaubt wäre. Die Folge: Testurteil mangelhaft. Auch ein weiteres Fabrikat überschritt den Richtwert – die Fischstäbchen der Rewe-Eigenmarke enthielten laut Bericht das Doppelte des zulässigen Gehalts für Raps- und Sonnenblumenöl und wurden entsprechend abgewertet. Doch selbst die restlichen Fischstäbchen im Test blieben nicht ohne Befund: In den meisten Produkten fanden sich 3-MCPD-Fettsäureester in der Kruste. Zwar lagen die gemessenen Mengen teils unterhalb strenger Grenzwerte, einen echten Grund zur Entwarnung gab es aber nicht. LAVES bestätigt unabhängig von Warentest: 3-MCPD ist ein unerwünschter Stoff, der zwar in vielen Lebensmitteln vorkommen kann, dessen Aufnahme jedoch nach Möglichkeit minimiert werden sollte.
Neben der Schadstoffanalyse prüfte Stiftung Warentest übrigens auch andere Kriterien. So flossen der Geschmack, Geruch und die Konsistenz der Stäbchen ebenso in die Bewertung ein wie die mikrobiologische Qualität (Keimfreiheit) und die Nährwertzusammensetzung. Erfreulicherweise waren Verunreinigungen durch Keime (etwa Salmonellen) in allen Proben kein Problem. Geschmacklich konnten einige Fischstäbchen überzeugen – doch hohe Salz- und Fettgehalte in der Panade trübten oft das ernährungsphysiologische Urteil. Alles in allem vergab Warentest letztlich nur zweimal die Note “Gut”: Testsieger wurden die klassischen Fischstäbchen von Frosta, dicht gefolgt vom Produkt von Alnatura, das zugleich aufgrund nachhaltiger Fangmethoden als “Umwelttipp” ausgezeichnet wurde. Fünf weitere Fischstäbchen waren immerhin befriedigend, der Großteil erhielt jedoch nur ein ausreichend – ein deutliches Zeichen, dass hier Verbesserungsbedarf besteht.
Die Fischstäbchen-Regel: Wie viele sind unbedenklich?
Nach diesen Befunden stellt sich für viele die Frage: Wie viele Fischstäbchen darf man (oder das Kind) denn nun essen, ohne die Gesundheit zu gefährden? Eine pauschale Verbots-Empfehlung gibt es nicht – doch Verbraucherorganisationen raten zu Maß und Ziel. Stiftung Warentest hat eine einfache Faustregel formuliert, die inzwischen als “Fischstäbchen-Regel” durch die Medien geht: Kleinkinder im Kita-Alter sollten maximal drei Fischstäbchen pro Mahlzeit verzehren, Schulkinder und Erwachsene höchstens fünf Stück. Diese Empfehlung stützt sich auf die gemessenen 3-MCPD-Gehalte und das Körpergewicht: Bei einem etwa 16 Kilogramm schweren Kind wären mit drei Fischstäbchen die täglich tolerierbare Aufnahmemenge von 3-MCPD nahezu erreicht. Bei fünf Stäbchen für einen Erwachsenen mit rund 60–80 kg liegt man ungefähr im Rahmen des als unbedenklich geltenden TDI-Werts. Mehr sollte es pro Tag nicht sein.
Sowohl Warentest als auch LAVES betonen zudem, dass man panierte Fertigfisch-Produkte generell nur in Maßen genießen sollte. Die Fachleute raten, Fischstäbchen und ähnliche vorfrittierte Lebensmittel (wie Chicken Nuggets oder panierte Veggie-Schnitzel) nur gelegentlich und in eher kleinen Portionen zu verzehren. Täglich Fischstäbchen zu Mittag – das ist keine gute Idee. Zum einen ließe sich dadurch über die Zeit der empfohlene Grenzwert für 3-MCPD überschreiten; zum anderen sind diese Produkte oft reich an Fett und Salz und liefern weniger Nährstoffe als frischer Fisch. Die Devise lautet also: lieber ab und zu als regelmäßiges Highlight, nicht als Grundnahrungsmittel.
Vegane Fischstäbchen: Bessere Alternative oder trügerische Sicherheit?
Angesichts der Probleme mit Fettschadstoffen in herkömmlichen Fischstäbchen könnte man auf die Idee kommen, einfach auf pflanzliche Alternativen umzusteigen. Tatsächlich boomt der Markt für vegane Fischstäbchen auf Basis von Soja, Weizen oder Gemüse. Doch sind diese wirklich gesünder und weniger belastet? Die Testergebnisse geben ein differenziertes Bild: Von den vier veganen Fischstäbchen-Alternativen im Warentest schaffte keine ein besseres Qualitätsurteil als “befriedigend”. Zwar entfällt hier das Thema überfischter Fischbestände – doch in puncto Schadstoffgehalt und Nährwert waren die Ergebnisse kaum besser als bei den klassischen Produkten.
Auch in den veganen Panaden wurden 3-MCPD-Ester nachgewiesen. In einem Fall stellten die Prüfer sogar einen erhöhten Gehalt fest, der zur Abwertung führte. Darüber hinaus fanden sich in manchen pflanzlichen Stäbchen weitere Rückstände: So wies das bestplatzierte Veggie-Produkt (Kaufland Take it veggie Knusperstäbchen) unter anderem gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH) in der Panade nach, also unerwünschte Mineralölrückstände. Ernährungsphysiologisch sind vegane Stäbchen ebenfalls nicht automatisch besser: Häufig enthalten sie vergleichbar viel Fett und Salz wie Fischstäbchen, aber dafür weniger Jod und Protein – beides Nährstoffe, die echter Seefisch von Natur aus liefert. Im Klartext: Wer aus gesundheitlichen Gründen zu Veggie-Fischstäbchen greift, sollte nicht erwarten, damit unbegrenzt schlemmen zu können. Auch diese Produkte sollten nur gelegentlich auf dem Speiseplan stehen, da sie ähnlichen Einschränkungen unterliegen wie das Original.
Das heißt nicht, dass pflanzliche Alternativen sinnlos wären – sie haben andere Vorteile, insbesondere mit Blick auf Tierwohl und Umwelt (dazu gleich mehr). Geschmacklich konnten einige vegane Sticks im Test durchaus mithalten, auch wenn der typische “Fischgeschmack” nicht immer erreicht wurde. Wichtig ist jedoch, keine falsche Sicherheit anzunehmen: Panade bleibt Panade, ob mit Fisch oder ohne. Die knusprige Kruste bringt bestimmte Risiken mit sich – egal, ob das Stäbchen aus Alaska-Seelachs oder Sojaprotein besteht.
Praktische Tipps: So reduzieren Sie Schadstoffe beim Fischstäbchen-Genuss
Wer auf Fischstäbchen nicht verzichten möchte, kann mit ein paar einfachen Maßnahmen dafür sorgen, die Schadstoffaufnahme so gering wie möglich zu halten. Zum einen hilft natürlich bereits die oben genannte Mengenbegrenzung – also nicht die ganze Packung auf einmal verputzen, sondern sich an 3 bis 5 Stück pro Portion orientieren. Zum anderen spielt die Zubereitung eine Rolle: Experten empfehlen, Fischstäbchen am besten im Backofen zuzubereiten statt in der Pfanne mit zusätzlichem Öl oder gar in der Fritteuse. Durch das Aufbacken im Ofen werden die Stäbchen knusprig, ohne dass sie weiteres Fett aufnehmen. Das schont die Gesundheit doppelt: Zum einen bleibt der Fettgehalt niedriger, zum anderen verhindert man, dass durch stark erhitztes zusätzliches Öl weitere 3-MCPD-Estermengen entstehen. Wer dennoch in der Pfanne brät, sollte nur wenig Öl verwenden und dieses nicht zu stark erhitzen – rauchendes Öl ist ein No-Go, da sich dabei vermehrt schädliche Verbindungen bilden können. Nach dem Braten kann es sinnvoll sein, die Stäbchen kurz auf Küchenpapier abtropfen zu lassen, um überschüssiges Fett (und eventuell darin gelöste Schadstoffe) zu entfernen.
Ein weiterer Tipp: Achten Sie auf die Qualität der Produkte. Unterschiede in der Herstellung können dazu führen, dass manche Fischstäbchen weniger belastet sind als andere. So haben im Warentest zwei Produkte – Frosta und Alnatura – vergleichsweise geringe Schadstoffgehalte gezeigt und wurden als einzige mit “gut” bewertet. Komplett ohne 3-MCPD war zwar auch bei diesen nicht möglich, doch die gemessenen Mengen waren so niedrig, dass die Tester den Verzehr als nicht gesundheitsbedenklich einstuften. Verbraucher können sich an solchen Testsiegern orientieren oder gezielt nach Herstellern fragen, welche Öle und Verfahren beim Frittieren verwendet werden. Ein Blick auf Tests von Stiftung Warentest oder Öko-Test kann lohnen, um Marken mit geringerer Schadstoffbelastung zu finden.
Nicht zuletzt gilt: Variieren Sie Ihre Fischgerichte. Anstatt jedes Mal panierten Fisch zu servieren, kann man ab und zu auf ungepannten Fisch ausweichen – etwa gedünstetes Lachsfilet, Fischfrikadellen oder Seelachs natur. Diese liefern das gewünschte Eiweiß und Omega-3-Fett, ohne dass eine Panade als möglicher Schadstoffträger dabei ist. Und wer gerne experimentiert: Vielleicht mal selbstgemachte Fischstäbchen ausprobieren? Mit panierter Zucchini oder selbst panierten kleinen Fischfilets (moderat in der Pfanne gebraten) hat man die volle Kontrolle über die Zutaten und das Öl – und damit potenziell weniger 3-MCPD-Risiko.
Nachhaltigkeit: Wie umweltverträglich sind Fischstäbchen?
Abseits der gesundheitlichen Fragen lohnt sich ein Blick auf die Ökobilanz der beliebten Stäbchen. Denn Fischstäbchen bestehen hauptsächlich aus wildgefangenem Seefisch – meist Alaska-Seelachs (auch als Pazifischer Pollack bekannt), seltener Kabeljau oder andere Weißfischarten. Die industrielle Fischerei steht weltweit unter Druck: Überfischung und umweltschädliche Fangmethoden bedrohen die Meeresökosysteme. Umweltorganisationen sind in Bezug auf Alaska-Seelachs gespalten. Zwar tragen viele Fischstäbchen-Packungen das blaue MSC-Siegel für nachhaltige Fischerei, doch etwa Greenpeace und der WWF sehen diese Fischart kritisch. Laut Greenpeace-Fischratgeber ist Alaska-Seelachs derzeit “nicht nachhaltig” – die Organisation rät vom Verzehr dieser Art komplett ab. Grund ist vor allem die Fangmethode: Häufig wird mit Grundschleppnetzen am Meeresboden gefischt, was den Lebensraum am Boden zerstören kann. Auch der WWF bewertet Alaska-Seelachs in seinen Empfehlungen nur eingeschränkt positiv. Ein Ökotest-Bericht von 2020 bemängelte beispielsweise an den Alnatura-Fischstäbchen (die Bio-Zutaten haben), dass trotz Naturland-Siegel der eingesetzte Seelachs mit einer problematischen Methode gefangen wird. Hier zeigt sich: Nachhaltigkeit ist komplex und hängt stark von Fanggebieten und -techniken ab.
Dennoch gibt es Fortschritte: Einige Hersteller setzen auf schonendere Fanggeräte oder beziehen ihren Fisch aus zertifiziert verantwortungsvollen Quellen. So stammt der Alaska-Seelachs in den Alnatura-Stäbchen laut Warentest überwiegend aus Fischereien mit Naturland-Siegel, deren Bestände als nicht gefährdet gelten. Dafür gab es von Stiftung Warentest den Titel “Umwelttipp”. Generell sollten Verbraucher beim Kauf von Fischstäbchen auf Siegel wie MSC (Marine Stewardship Council) oder Naturland achten, die auf nachhaltigere Herkunft hinweisen. Allerdings ersetzen Siegel nicht die Maßhaltung: Auch nachhaltig gefangener Fisch entnimmt der Natur Ressourcen – ein bewusster Konsum bleibt wichtig.
Eine Alternative sind wie erwähnt die pflanzlichen Fischstäbchen, und hier zeigen sich deutliche Vorteile in der Ökobilanz. Eine aktuelle Analyse des WWF hat die Umweltbelastung von herkömmlichen Fischstäbchen mit der von veganen Stäbchen verglichen. Das Resultat: Die Produktion von Fischstäbchen aus Seelachs verursachte im Schnitt eine 3,6-fach höhere Umweltbelastung als die ihrer pflanzlichen Pendants. Selbst wenn man die Nährstoffgehalte mit einbezieht, schnitten die veganen Alternativen besser ab. Der WWF nennt den Ersatz von Fisch durch Pflanzenproteine eine „gute Möglichkeit, den Konsum von Fisch und Meeresfrüchten zu reduzieren und damit die weltweite Überfischung einzudämmen“. Hauptgründe für die schlechtere Bilanz der Fischstäbchen sind neben der Entnahme von Meerestieren die Treibhausgas-Emissionen der Fangflotten: Die Dieselverbrennung auf Fischereischiffen trägt erheblich zum CO₂-Ausstoß bei. Zwar entstehen auch bei Anbau und Verarbeitung pflanzlicher Zutaten Emissionen, doch insgesamt schneiden Fischstäbchen in allen Umweltkategorien deutlich schlechter ab als vegane Stäbchen. Mit anderen Worten: Aus ökologischer Sicht sind pflanzliche Fischstäbchen die klimafreundlichere Wahl.
Fazit: Genuss mit Köpfchen
Fischstäbchen bleiben ein praktisches und leckeres Essen, das keineswegs komplett vom Speiseplan verbannt werden muss. Doch die jüngsten Erkenntnisse zeigen, dass ein unbedachter Konsum Risiken bergen kann – sowohl für die Gesundheit (Stichwort 3-MCPD) als auch für die Umwelt (Stichwort Überfischung). Verbraucher sollten informiert und maßvoll genießen: Ab und zu ein paar Fischstäbchen, vorzugsweise im Ofen zubereitet und aus nachhaltig gefangenem Fisch – das kann man durchaus vertreten. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann hin und wieder auf pflanzliche Alternativen ausweichen oder frischen Fisch ohne Panade bevorzugen. Letztlich gilt die gleiche Regel wie bei den meisten verarbeiteten Lebensmittel: Maßhalten und Abwechselung. Dann steht dem gelegentlichen Fischstäbchen-Vergnügen – mit Kartoffelbrei und Erbsen vielleicht – nichts im Wege. Denn wie so oft macht die Dosis das Gift. Bleibt sie niedrig, darf man den knusprigen Klassiker weiterhin mit gutem Gewissen genießen.
Quellen: Stiftung Warentest, LAVES Niedersachsen, EFSA/BfR, WWF-Studie, t-online, Verbraucherinformationen (Öko-Test, Greenpeace) und eigene Recherchen.